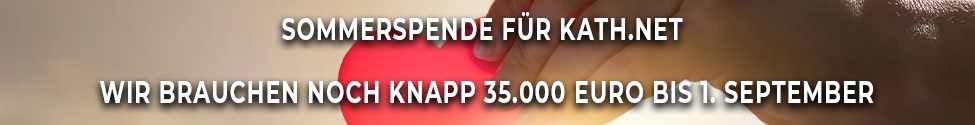

Aktuelles | Chronik | Deutschland | Österreich | Schweiz | Kommentar | Interview | Weltkirche | Prolife | Familie | Jugend | Spirituelles | Kultur | Buchtipp

vor 3 Tagen in Kommentar, 3 Lesermeinungen
Artikel versenden | Tippfehler melden
„Die Wahl Leos XIV. markiert einen Wendepunkt in der bischöflichen Theologie: Nicht Bruch, sondern spirituelle Vertiefung kirchlicher Tradition. Er spricht nicht von Reformplänen, sondern von Hoffnung.“ Von Archimandrit Dr. Andreas-Abraham Thiermeyer
Eichstätt (kath.net) Das erneuerte Amtsverständnis unter Papst Leo XIV. - in lehramtlicher Kontinuität
1. Einleitung: Aufbruch im Zeichen der Hoffnung
Die Wahl Leo XIV. markiert einen Wendepunkt in der bischöflichen Theologie: Nicht als Bruch, sondern als spirituelle Vertiefung kirchlicher Tradition. Im Angesicht einer erschütterten Welt spricht der neue Papst nicht von Reformplänen, sondern von Hoffnung. Diese Hoffnung ist keine Strategie, sondern Ausdruck gelebter Eschatologie, und sie prägt zentral das Bischofsbild seines Pontifikats.
2. Der Bischof als geistlicher Vater: Identität aus der Weihe
In enger Anlehnung an Lumen Gentium unterstreicht Leo XIV. die sakramentale Konstitution des Bischofsamtes. Der Bischof ist nicht gewählter Funktionär, sondern durch die Weihe ontologisch verändert: Ein Vater im Glauben, dessen Autorität aus seiner geistlichen Vaterschaft hervorgeht. Diese Dimension war bei Johannes Paul II tief verankert, der das Amt stets als Vaterschaft im Dienst der Heiligung verstand.
3. Christusrepräsentanz – zwischen Präsenz und Transparenz
Der Bischof repräsentiert Christus, nicht als Machtausübung, sondern als geistliches Zeichen. Leo XIV. führt diesen Gedanken in einer paradoxen Formel aus: „Der Bischof ist ein Fenster, nicht ein Spiegel Christi.“ Das bedeutet: Er verweist auf Christus, statt sich selbst zu präsentieren. Diese Linie steht in klarer Resonanz mit dem Bild des 'Demutsdienstes' bei Franziskus und den christologischen Tiefendimensionen bei Benedikt XVI.
4. Das Bischofsamt als personale, nicht administrative Wirklichkeit
In einer zunehmend verwalteten Kirche ruft Leo XIV. eindringlich zur „Repersonalisierung des Bischofsamtes“ auf. D.h. der Papst ruft zu einer bewusst theologisch akzentuierten Rückführung des bischöflichen Dienstes auf seine personale, geistliche und existenzielle Dimension auf. Im Unterschied zu einer vorwiegend funktionalen, organisatorischen oder administrativen Betrachtungsweise, wie sie in modernen kirchlichen Verwaltungsstrukturen Debatten zunehmend sichtbar wurde.
Leo XIV. erinnert daran, dass das Bischofsamt nicht zuerst ein Amt im Sinne von Büro oder Behörde ist, sondern eine personale Sendung, die in der Weihe begründet ist. Diese stellt den Bischof sakramental in eine Christusrepräsentanz, nicht bloß in eine Leitungsposition. Leo XIV. betont dies besonders stark: „Der Bischof ist nicht ein Funktionsträger der Verwaltung, sondern ein von Christus geformter Vater der Gemeinde.“
In der heutigen westlichen kirchlichen Realität wird das Bischofsamt häufig verwaltungsförmig wie ein „CEO („Chief Executive Officer“ in einem Unternehmen) einer Diözese“, juristisch reguliert und strategisch delegiert (durch Generalvikare, Ausschüsse, Gremien). Dies führte teilweise zur Verwischung der spirituellen Autorität zugunsten von Strukturen, die durchaus oft notwendig, aber oft nicht identitätsstiftend sind.
Die „Repersonalisierung des Bischofsamtes“, so Papst Leo XIV., meint die „Wiederentdeckung des Bischofs als geistliche Person, die in ihrer eigenen Christusbeziehung, nicht in der Effizienz der Strukturen, die Quelle für Lehre, Leitung und Seelsorge findet.“ „Verantwortung beginnt im Gebet“, so seine Maxime. Das Amt sei vor allem personale Präsenz, sichtbar im Gebet, im Zuhören, in der leiblichen Nähe. Damit kritisiert er eine Tendenz zur „Managerialisierung“, wie sie zuletzt immer wieder im Kontext kirchlicher Strukturdebatten aufkam.
5. Der dreifache Dienst als Einheit: Leiten, Lehren, Heiligen
Leo XIV. rehabilitiert das klassische tria munera-Modell, doch nicht funktionalistisch, sondern spirituell. „Der Bischof führt, indem er heiligt, und lehrt, indem er dient.“ Dieses Ineinandergreifen ist für ihn der Schlüssel bischöflicher Identität. Hier zeigt sich eine Brücke zwischen der Lehramtsklarheit Benedikts und der Diensttheologie Franziskus’.
6. Der Horizont der Weltkirche: Der Bischof als Brücke
Leo XIV. sieht den Bischof nicht nur lokal, sondern in weltkirchlicher Verantwortung. Das bischöfliche Amt sei eine Brücke zwischen Kulturen, Generationen und geistlichen Traditionen. Johannes Paul II hatte in seinem globalen Verständnis des Papsttums diesen Horizont stark geprägt. Leo XIV. übernimmt ihn, jedoch mit stärkerer Gewichtung auf die spirituelle Verantwortung in synodaler Weite.
Fazit: Erneuerung aus Kontinuität
Das bischöfliche Amtsverständnis unter Leo XIV. ist tief verwurzelt in der Tradition – und dennoch voller neuer Akzente. Der Fokus auf geistliche Vaterschaft, Präsenz statt Funktion, synodale Leitung und personale Transparenz verbindet das Beste seiner Vorgänger mit einem eigenen, geisterfüllten Stil. In einer Welt der Polarisierungen wirkt dies nicht defensiv, sondern wie ein Aufbruch aus der Mitte des Glaubens.
II. Perspektiven und Aufgaben des bischöflichen Dienstes unter Papst Leo XIV. – in Kontinuität seiner Vorgänger
1. Zeugen der Hoffnung: "Spes non confundit" als Schlüssel
Kaum ein anderer biblischer Vers hat das Pontifikat Leo XIV. so durchdrungen wie Röm 5,5: 'Spes non confundit', „die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen“. Aus einer spirituellen Maxime wird hier ein kirchliches Programm. Leo XIV. versteht die Hoffnung nicht als psychologisches Trostpflaster, sondern als widerständige Kraft, die dem Bischof auch 'gegen den Strom' Orientierung gibt.
Darin steht er der Vision Papst Franziskus’ nahe, der die 'Kirche an den Rändern' als privilegierten Ort des Evangeliums beschreibt. Doch Leo XIV. ergänzt: Hoffnung dürfe nicht nur gepredigt, sie müsse gegenwärtig sein, durch konkrete Nähe, dialogische Präsenz und geistliche Authentizität. Anders als Benedikt XVI., der die Hoffnung dogmatisch vertiefte (Spe Salvi, 2007), sieht Leo XIV. ihre Glaubwürdigkeit in der bischöflichen Lebensform selbst verwurzelt.
2. Pastoral als "Dienst der Liebe" – Augustinisches Leitbild
Eines der stärksten programmatischen Bilder findet sich in Leo XIV.s Bezug auf Augustinus: das amoris officium, der 'Dienst der Liebe'. Der Bischof soll nicht zuerst verwalten oder lehren, sondern lieben, in einer Weise, die nicht sentimental, sondern theologisch fundiert ist. Liebe wird zum Schlüssel für die Ausübung der Wahrheit und der Autorität.
Johannes Paul II sprach in Pastores Gregis (2003) vom Dienst an der Wahrheit „in Liebe“. Leo XIV. kehrt die Reihenfolge um: Die Liebe ist der Ausgangspunkt, die Wahrheit ihre Frucht. Damit steht er ganz in der Linie Franziskus’, der immer wieder mahnte: 'Der Hirte führt mit dem Herzen.'
3. Leitung als geistgewirkte Klugheit – Synodalität als Stil
Eine zentrale Betonung Leo XIV. liegt in seiner Deutung bischöflicher Leitung. Er spricht von einer 'pastoralen Klugheit', die nicht Taktik oder strategische Kontrolle meint, sondern eine von Gebet, Dialog und Hören durchformte Haltung. In dieser Perspektive wird Synodalität nicht zum Struktur- oder Mehrheiten Prinzip, sondern zur geistlichen Disposition.
Franziskus hatte den „Weg der Synodalität“ als göttlichen Wunsch für die Kirche des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Leo XIV. verdeutlicht diesen Gedanken: Der Bischof ist kein Solist mehr, er ist aber auch mehr als nur ein geistlicher Moderator eines gemeinsamen Weges, im Hören auf den Heiligen Geist ebenso wie auf die Gläubigen. Er hat letztlich die Verantwortung der Unterscheidung und der Entscheidung, die er nicht ohne weiteres delegieren kann. Benedikts Bild des „Hüters des Glaubens“ wird dabei nicht aufgegeben, sondern in die Form des kollegialen Hinhörens in Verantwortung transformiert.
4. Armut und Keuschheit: Zeichen gelebter Glaubwürdigkeit
„Die Armen müssen in ihm einen Vater und Bruder sehen“, mit dieser Aussage rückt Leo XIV. die Evangeliums gemäße Armut ins Zentrum bischöflicher Existenz. Der Bischof soll einfach leben, mitfühlend handeln und in der Nähe zu den Bedürftigen sein Zeugnis ablegen.
In diesem Punkt setzt Leo XIV. eine klare Linie fort, die Franziskus mit dem Wunsch nach einer „armen Kirche für die Armen“ stark gemacht hatte. Doch er vertieft sie geistlich: Armut ist nicht nur strukturell-ökonomisch zu verstehen, sondern ein Habitus des Herzens.
Ebenso betont Leo XIV. die spirituelle Dimension des Zölibats. Dieser sei kein Verzicht um des Verzichts willen, sondern Ausdruck „herzlicher Reinheit“, Klarheit und Lauterkeit, einer Haltung, die Missbrauch nicht duldet, sondern durch geistliche Transparenz überwindet. In einer Kirche, die mit Vertrauensverlust ringt, setzt Leo XIV. auf spirituelle Authentizität statt bloßer Disziplin.
5. Menschliche Tugenden und geistliche Transformation
In ungewohnter Deutlichkeit nennt Leo XIV. Tugenden wie Aufrichtigkeit, Großherzigkeit und Offenheit des Herzens als Grundanforderungen an den Bischof. Dabei zitiert er Presbyterorum Ordinis und betont zugleich: Charakterbildung sei keine psychologische Technik, sondern eine Frucht geistlicher Wandlung. Auch schwierige Persönlichkeiten im geistlichen Dienst könnten „durch Christus verwandelt“ werden.
Hier spiegelt sich eine zentrale Überzeugung des Pontifikats: Der Bischof wird nicht durch Management und Strategie geschult, sondern durch die Vertiefung in das Gebet, die Eucharistie und die aufrichtige Gemeinschaft und Nähe mit seinem Presbyterium.
6. Geistliche Gemeinschaft statt bürokratischer Struktur
„Fördert stets die Einheit im Presbyterium“ – dieser Appell bildet den Schlussakkord bischöflicher Leitungsvision bei Leo XIV.. Gemeinschaft, so der Papst, sei nicht primär institutionell, sondern geistlich: getragen vom Gebet, gegenseitigem Vertrauen und echter Brüderlichkeit.
Diese Sicht steht in starker Kontinuität zu Benedikts Konzept von „Liebe in Wahrheit“ (Caritas in veritate) und zugleich in Resonanz mit Franziskus’ Dialogverständnis. Doch Leo XIV. setzt den Ton anders: Der Bischof ist nicht Verwalter von Netzwerken, sondern geistlicher Mittelpunkt einer betenden Kirche.
Fazit: Kontinuität in geistlicher Erneuerung
Papst Leo XIV. präsentiert keinen Bruch in seiner Sicht des bischöflichen Dienstes, sondern eine Vertiefung lehramtlicher Linien unter den Vorzeichen einer leidenden Welt. In Hoffnung, Liebe, Leitung und Lebensstil bringt er theologische Tiefe mit pastoraler Erfahrung in Einklang. Die bischöfliche Sendung erscheint so zugleich erneuert und verwurzelt, als bleibendes Zeugnis der Hoffnung, die nicht zugrunde geht.
________________________________________
Literatur
Lehramtliche Dokumente (päpstlich und konziliar)
• Zweites Vatikanisches Konzil:
Lumen Gentium – Dogmatische Konstitution über die Kirche, 1964.
Presbyterorum Ordinis – Dekret über Dienst und Leben der Priester, 1965.
• Johannes Paul II:
Pastores Gregis – Nachsynodales Apostolisches Schreiben über den Bischof als Diener des Evangeliums Jesu Christi für die Hoffnung der Welt, 2003.
• Benedikt XVI.:
Spe Salvi – Enzyklika über die christliche Hoffnung, 2007.
Caritas in veritate – Enzyklika über die ganzheitliche Entwicklung des Menschen, 2009.
• Franziskus:
Evangelii Gaudium – Apostolisches Schreiben über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute, 2013.
Christus Vivit – Nachsynodales Apostolisches Schreiben über die Jugend, 2019.
Ansprache zur Eröffnung des Synodalen Weges, 2015 und fortlaufende Texte zur Synodalität.
• Spes non confundit – Jubiläumsbulle zum Jahr der Hoffnung, 2025.
• Leo XIV.
Ansprachen an die Bischöfe zum bischöflichen Dienst, an die Priester, an die Seminaristen, 2025
Theologische Fachliteratur zur Bischofstheologie
• Walter Kasper: Der Bischof – Diener des Evangeliums Jesu Christi, Herder, 2003.
• Gerhard Ludwig Müller: Priestertum und Leitungsamt, in: Joseph Ratzinger u. a., Priestertum und Kirche, Augsburg, 2000.
• Hermann Josef Pottmeyer: Das Amt des Bischofs im Dienst der Einheit, Herder, 1999.
• Helmut Hoping: Dogmatik kompakt, Herder, 2019 (Kapitel zu Sakrament der Weihe).
• Gisbert Greshake: Priestersein – Eine theologische Grundlegung, Herder, 2009.
• Christoph Theobald SJ: Das Bischofsamt im Zeichen synodaler Konversion, in: Stimmen der Zeit 11/2022, S. 721–732.
• Paul M. Zulehner: Seelsorge in Zeiten der Umkehr, Patmos, 2021.
Spirituelle und patristische Quellen
• Augustinus: Sermo 340: Amoris officium – Die Liebe als Bischofsdienst.
• Gregor der Große: Regula Pastoralis – Die Pastoralregel.
• Romano Guardini: Der Herr, Mainz 1937 (für das Christusbild des Bischofs).
• Henri de Lubac: Meditationen über die Kirche, Johannes Verlag, 1985.
Über den Autor
Archimandrit Dr. Andreas-Abraham Thiermeyer ist Theologe mit Schwerpunkt auf ökumenischer Theologie, Ostkirchenkunde und ostkirchlicher Liturgie. Er studierte in Eichstätt, Jerusalem und Rom, war in verschiedenen Dialogkommissionen tätig, Konsultor der Ostkirchenkongregation in Rom, Gründungsrektor des Collegium Orientale in Eichstätt und veröffentlicht regelmäßig zu Fragen der Ostkirchen-Theologie, der Liturgie der Ostkirchen und des Frühen Mönchtums.
Foto: Papst Leo/Pallium (c) Vatican News
Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!
modernchrist vor 2 Tagen: Dieser Papst
bringt Nahrung für die Seele, zündet Leuchten an für Verwirrte, zeigt klare Ziele auf für labile oder hin- und hergeworfene Leitungspersonen, gibt den Bischöfen eine Aufgabe und eine Beruf(ung)sbeschreibung, die sie nicht vor Gremien rechtfertigen müssen.
Triceratops vor 2 Tagen: Die Latte ist ziemlich hoch gelegt,
zumindest aus der Sicht europäischer Bischöfe. Es ist aber machbar. Ein früherer Bischof einer peruanischen Diözese namens Chiclayo hat es uns vorgelebt.
https://www.youtube.com/watch?v=10k3XI_c6jc
Hope F. vor 2 Tagen: Nachahmenswert
Dieser Papst bringt es auf den Punkt und lebt glaubhaft vor, was er predigt. Vertiefung im Gebet, Authentizität und Tugenden. Daran mangelt es vielen - Priester eingeschlossen. Aber genau das ist es was zählt und wonach sich so viele im Geheimen sehnen. Ich wünsche mir, daß möglichst viele Priester seinem Beispiel folgen. Denn seine Worte sind Nahrung für die Seele, die heutzutage mehr dürstet als je zuvor. Ich wünsche mir solch einen Pfarrer für unsere Gemeinde, damit der Glaube wieder gelebt und die Gottesdienste wieder besser besucht werden.
Um selbst Kommentare verfassen zu können nützen sie bitte die Desktop-Version.

© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz